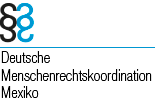2.TÜBINGER-ELISABETH-KÄSEMANN-SYMPOSIUM
21. Juni 2017, Audimax der Eberhard Karls Universität Tübingen
WILLKOMMEN UND GRUSSWORTE
Prof. Dr. Jörg Eisele, Dr. Dorothee Weitbrecht, Theresa Schopper, Dr. Christine Arbogast
Die Veranstalter des 1.Tübinger Elisabeth-Käsemann-Symposiums samt Kolloquium – Prof. Dr. Jörg Eisele, Inhaber des Lehrstuhls für deutsches und Europäisches Straf- und Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Computerstrafrecht, und Dr. Dorothee Weitbrecht, Geschäftsführerin der Elisabeth Käsemann Stiftung – richteten einleitende Worte des Willkommens an die etwa dreihundert Zuhörer. Schon die am Symposium teilnehmenden hochrangigen Gäste seien ein Indiz für die gesellschaftliche und wissenschaftliche Relevanz des Themas des Symposiums, erklärte Eisele. Die Aktualität und Bedeutung internationaler Strafverfolgung zeige sich in der Bereitstellung von internationalen Rechtsinstrumenten wie der UN-Konvention gegen das Verschwindenlassen von Menschen. So komplex eine Strafverfolgung in mehr als einem Land sei, so hänge die Wirksamkeit dieses Instruments von seiner „konsequenten Anwendung“ ab. Um der nachfolgenden Generation von Juristinnen und Juristen die Bedeutung des Themas zu vermitteln, wurde zusätzlich zum Symposium ein juristisches Fachkolloquium veranstaltet, das seitens der Studierenden und Nachwuchswissenschaftler mit großem Interesse aufgenommen wurde.

Dorothee Weitbrecht war es in ihrer Willkommensansprache wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Gründungsmotiv der Elisabeth Käsemann Stiftung die Ermordung von Elisabeth Käsemann gewesen sei. Die Stiftung diene aber nicht der Erinnerung an eine Person und deren Leben, sondern an die Opfer staatlicher Menschenrechtsverbrechen. Damit verbunden sei der allgemeine Auftrag, sich präventiv auf bildungspolitischer Ebene für die Stärkung demokratischer Rechte und den Schutz der Menschenrechte einzusetzen. Zugleich würdigte Weitbrecht das Engagement der Menschen, deren Einsatz dazu führte, dass im Jahr 2003 erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Haftbefehle gegen ehemalige ausländische Machthaber ausgestellt wurden: die Mitglieder der „Koalition gegen Straflosigkeit“, Bundesjustizministerin a.D. Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin, den Nürnberger Oberstaatsanwalt Walter Grandpair, die Rechtsanwälte Konstantin Thun und Roland Beckert und den Berliner Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kaleck.

Theresa Schopper, Staatssekretärin im Staatsministerium Baden-Württemberg, wies in ihrem Grußwort daraufhin, dass das Elisabeth-Käsemann-Symposium und -Kolloquium nicht nur durch die Zusammenarbeit zwischen Bund, Land und Stadt, Hochschule, Justiz, Zivilgesellschaft, Studierenden sowie Bürgerinnen und Bürgern einen besonderen Wert erhalte, sondern auch durch die Unterstützung der lateinamerikanischen Gäste. Sie erinnere sich noch gut an die Zeit, als in Argentinien die Menschen verschwanden, und an den Protest der Madres de Plaza de Mayo. Es sei ihr ein Anliegen, dass die neue Generation der Studierenden das Thema Menschenrechte aufgreife und sich damit auseinandersetze. Alle am Symposium Mitwirkenden und Beteiligten würden sich für Menschenrechte in Zeiten engagieren, in denen sie vielerorts in besonders eklatanter Weise verletzt würden. Dabei seien sie das Fundament einer offenen Gesellschaft. „Denken und Handeln“ im Sinne der Menschenrechte werde in vielen Regionen unterdrückt. Ein offener Austausch zwischen Politik, Wissenschaft und Gesellschaft wie an diesem Abend biete eine Chance, „die Welt nachhaltiger und gerechter zu gestalten“. Die Möglichkeit zu diesem Austausch müsse in den Kontext gestellt werden, dass er andernorts mit Lebensgefahr verbunden sei.

Dr. Christine Arbogast, Erste Bürgermeisterin der Stadt Tübingen, machte in ihrer Begrüßung auf die begleitende Tübinger Ausstellung „Was damals Recht war…“ aufmerksam, die „Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht“ und die Aufarbeitung dessen in den Blick nehme. Hier sei der Fall von Elisabeth Käsemann exemplarisch nicht nur für Verbrechen „staatlicher Herrschafts- und Justizsysteme“, sondern auch für die „mangelhafte und äußerst langwierige Aufarbeitung“ solchen staatlichen Fehlverhaltens, nicht zuletzt erschwert durch die Bedingungen einer grenzüberschreitenden Justiz. Mit dem Symposium werde auch noch einmal an die Aufgabe des Staates erinnert, die „pluralistische Verfasstheit der Gesellschaft“ zu schützen und die demokratische Gemeinschaft zu fördern. Die Kommunen kämen ihrer Verantwortung in den verschiedenen Bildungseinrichtungen, Vereinen und Institutionen nach. Auch die Elisabeth Käsemann Stiftung leiste in diesem Sinne mit ihren deutsch-lateinamerikanischen Schulprojekten einen wertvollen Beitrag zur Bildungsarbeit.


KEYNOTE
Bundesrichter Prof. Dr. Daniel Eduardo Rafecas (Argentinien)
In seiner Keynote erläuterte der argentinische Bundesermittlungsrichter Prof. Dr. Daniel Eduardo Rafecas zunächst die politischen und gesellschaftlichen Hintergründe der Entstehung der argentinischen Militärdiktatur, die von 1976 bis 1983 herrschte. Nachdem die Militärjunta die Macht übernommen habe, hätte sie unter Führung des Heeres einen gigantischen Machtapparat aus Heer, Marine und Luftwaffe geschaffen, der alle oppositionellen Gruppen und Personen „ausmerzen“ sollte. Dazu sei das ganze Land in Zonen aufgeteilt gewesen, die dem Führungspersonal der drei Streitkräfte unterstellt gewesen seien. Speziell gebildete Einsatzgruppen entführten ihre Opfer in geheime Haftzentren, wo sie sie folterten und töteten. Zwischen 1976 und 1977 existierten etwa 500 solcher Haftzentren, die bis zu 300 Gefangene aufnehmen konnten. Man gehe von 30.000 Opfern aus (auch wenn die Zahl heutzutage schwierig zu beziffern sei), von denen nur wenige überlebt haben. Es überlebten auch die etwa 500 Kinder und Babys, die ihren Müttern weggenommen wurden, um sie Militärangehörigen und deren Angehörigen zur Adoption zu übergeben.




PODIUMSDISKUSSION
Teilnehmer:
Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin, Bundesjustizministerin a.D.
leer
Prof. Dr. Daniel Rafecas (Argentinien), Bundesermittlungsrichter und Professor an der Juristischen Fakultät der Universität Buenos Aires
leer
Prof. Dr. Luis Efrén Ríos Vega (Mexiko), Generaldirektor der Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) und der Clínica Internacional de Derechos Humanos (CIDH)
leer
Leitender Oberstaatsanwalt Jens Rommel, Leiter der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, Ludwigsburg
Moderation:
Dr. Christiane Schulz, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin
Schulz eröffnete die Podiumsdiskussion mit einem Zitat des Generalstaatsanwaltes Fritz Bauer (1903-1968), der eine Schlüsselfigur bei der Aufarbeitung von NS-Verbrechen gewesen ist und über den anlässlich des Elisabeth-Käsemann-Symposiums das Haus der Geschichte eine in Zusammenarbeit mit den Schülern des Stuttgarter Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums entstandene Ausstellung in der Neuen Aula der Tübinger Universität zeigte. Die Bundesrepublik, so habe Bauer gesagt, könne ohne eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Nazi-Zeit und ihren Verbrechen keine dauerhaft stabile soziale und gerechte Ordnung entwickeln. Verdrängung verhindere Gerechtigkeit und damit einen dauerhaften Neuanfang.

Däubler-Gmelin habe als Juristin, Bundestagsabgeordnete und Bundesjustizministerin aus unterschiedlichen Perspektiven eine Vielzahl von Hindernissen in der Aufklärung oder strafrechtlichen Verfolgung von NS-Verbrechen wahrgenommen. Es stelle sich die Frage, welche dieser Hindernisse besonders erwähnenswert seien, so Schulz. Däubler-Gmelin erläuterte, dass die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse Anfang der 1960er Jahre, als sie studiert habe, höchst umstritten gewesen seien. Man habe in Frage gestellt, ob es sich dabei um Rechtsprechung handele oder vielmehr um Siegerjustiz. Noch dazu habe die Justiz in Deutschland lange die Beteiligung am Staatsterrorismus geleugnet und eine Aufarbeitung abgelehnt. Fritz Bauer habe zu den wenigen Ausnahmen gezählt, die diese Haltung nicht geteilt hätten. Däubler-Gmelin nannte als Beispiel für diese Haltung die Verhängung des Todesurteils im Fall Dietrich Bonhoeffers, das skandalöserweise bis 1996 Rechtsgültigkeit besessen habe. Die besondere Bedeutung Bauers habe sich schon 1952 im Remer-Prozess gezeigt, als er erreicht habe, dass die Widerstandskämpfer des 20. Juli auch nach juristischer Auffassung legitimen Widerstand geleistet hätten und keine Landesverräter gewesen seien. Er habe schon hier eine Vorreiterrolle eingenommen und sei Vorbild für junge Juristinnen und Juristen gewesen. Von seinen Kollegen sei er allerdings gemieden und missachtet worden. So sei eine von Däubler-Gmelin als Studentin in Berlin organisierte Veranstaltung mit Fritz Bauer von der arrivierten Justiz ignoriert worden. Nicht ein Richter, Staatsanwalt oder Jura-Professor habe die Veranstaltung besucht.
Bezüglich der internationalen Strafverfolgung der argentinischen Staatsverbrechen gebe es viele Parallelen zu Chile, einschließlich des Versagens der deutschen Regierung, so Däubler-Gmelin. Vor diesem Hintergrund habe sie daher als Bundesministerin nicht nur die Verabschiedung des Römischen Statuts durchgesetzt, das mit einer Änderung des Grundgesetzes verbunden gewesen sei und von den USA höchst kritisch gesehen worden sei, sondern habe in ihrer Amtszeit auch das Völkerstrafgesetzbuch in Deutschland auf den Weg gebracht. Ohne die Unterstützung engagierter Wissenschaftler wäre dies nicht möglich gewesen.
Sich an Ríos Vega wendend wies Schulz daraufhin, dass in der Diskussion über internationale Strafverfolgung bisher der Fokus auf dem Staat als Täter als Täter aufgetreten sei. Ungleich komplexer stelle sich die aktuelle Situation in Mexiko dar. Hier gebe es sowohl staatliche Täter, wie beispielsweise staatliche Sicherheitskräfte, aber auch die Täter aus den Reihen der organisierten Kriminalität. 98 % der Täter blieben hier straflos, womit zugleich die Aufklärung der Verbrechen an sich im Dunkeln belassen werde. Welche Rolle in diesem Zusammenhang die internationalen Instrumente zum Menschenrechtsschutz spielen könnten, wollte daher Schulz von Ríos Vega, dem Generaldirektor der Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), wissen.
Ríos Vega erläuterte, dass sich der Kontext der heutigen Menschenrechtsverletzungen in Mexiko wie dem gewaltsamen Verschwindenlassen von den Menschenrechtsverletzungen der lateinamerikanischen Diktaturen unterscheide. Mexiko habe zwar in den letzten Jahren den Übergang zur Demokratie vollzogen, der Prozess sei aber noch nicht abgeschlossen. Es herrsche eine „allgemeine Praxis des Verschwindenlassens“, die durch internationale Menschenrechtsorganisationen dokumentiert sei. Mexiko sei in einem Falle, bei dem es sich um die klassische Form des staatlichen Verschwindenlassens einer Person aus politischen Gründen gehandelt habe, bereits vom Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof verurteilt worden. Seit der politischen Wende im Jahr 2000 existierten neben dieser klassischen Form des Verschwindenlassens durch den Staat aber gerade auch Fälle von Verschwindenlassen durch die organisierte Kriminalität. Der Staat versäume hier, seiner Verantwortung nachzukommen. Mexiko sei für das Versagen im Fall des Femizids von Juarez verurteilt worden, dies nicht weil der Staat hier Täter war, sondern im Kontext eines „failed state“, der seine Bürger nicht mehr schütze und die Unversehrtheit gefährdeter Bevölkerungsgruppen nicht mehr gewährleisten könne oder wolle. International bekannt gewordene Fälle dieser neuen Form des Verschwindenlassens seien die 43 Studierenden von Ayotzinapa und die Morde von San Fernando, wo es mindestens 289 Menschen Opfer gegeben habe. Aber das Verschwindenlassen durch die organisierte Kriminalität sei in allen Regionen des Landes verbreitet. Die lateinamerikanischen Diktaturen hätten den Tatbestand des gewaltsamen Verschwindenlassens auf internationaler Ebene in den Kontext der Verbrechen gegen die Menschlichkeit gestellt. In Mexiko benötige man allerdings neue Konzepte der Verantwortung eines Staates. Auch wenn der Staat bzw. seine Amtspersonen nicht die unmittelbaren Täter seien, sei sie in die Verbrechen verwickelt. Dies erfordere internationale Verantwortlichkeit und die Anerkennung dieses Verhaltens als Straftat. Der mexikanische Staat zähle offiziell etwa 26.000 Opfer im Krieg gegen den Drogenhandel, inoffiziell seien es aber mehr als 100.000 Verschwundene, was jedoch vom Staat nicht anerkennt werde, sodass weitgehende Straflosigkeit herrsche.
Däubler-Gmelin entgegnete Ríos Vega, es bestehe ja bereits eine internationale Verantwortlichkeit in solchen Fällen. In Mexiko gebe es eine eklatante Verletzung der Verpflichtung des Staates, den Schutz seiner Bürger zu gewährleisten. Zu den Pflichten eines Staates gehöre nicht nur die Anerkennung von Menschenrechten und die Ausrichtung des eigenen Handelns nach diesen Prinzipien, sondern auch der Schutz der Menschenrechte. Es sei zwar mit großen Schwierigkeiten verbunden, die mexikanischen Menschenrechtsverletzungen international aufzugreifen, zum Beispiel vor dem Internationalen Strafgerichtshof, aber es sei dennoch ein sehr wichtiger Ansatz.
Schulz verwies darauf, dass in der Konvention der Vereinten Nationen zum Schutz vor Verschwindenlassen dem neuen Täterprofil bereits Rechnung getragen werde, indem der Staat verpflichtet sei, Aufklärung zu leisten, wenn es sich bei den Tätern um private Akteure handele. Schulz bat Rafecas um seine Einschätzung, wie dauerhaft die juristischen Erfolge der letzten Jahre hinsichtlich der Vergangenheitsaufarbeitung in Argentinien seien, nachdem nun der Oberste Gerichtshof entschieden habe, dass Hafterleichterungen auch in Fällen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewährt werden könnten.
Rafecas bestätigte, dass der Oberste Gerichtshof Anfang Mai diesen Jahres im Zuge von Neubesetzungen der Richterstellen mit einem Ergebnis von 2 zu 3 überraschenderweise für die Anwendung eines Gesetzes aus dem Jahr 2001, das allerdings wenig später wieder aufgehoben worden sei, gestimmt habe. Danach sollte nach zwei Jahren Haft jeder Tag zweifach auf die reguläre Haftzeit angerechnet werden. Dies habe deutliche Haftverkürzungen zur Folge. Das Urteil habe eine äußerst erstaunliche, unerwartete und in der politischen Geschichte Argentiniens der letzten 30 Jahre seltene Reaktion ausgelöst. Die Gesellschaft habe eine starke und klare Botschaft ausgesandt. In Buenos Aires hätten am 10. Mai 2017 spontan 500.000 Menschen demonstriert. Keiner habe davon politisch profitiert; es habe keine Parteienpolitik und keine missionierenden Parolen gegeben. Die Demonstranten seien normale Bürgerinnen und Bürger gewesen, überwiegend junge Menschen. Sie alle hätten die weißen Tücher der Mütter und Großmütter der Plaza de Mayo getragen. Das Parlament habe daraufhin entschieden, dass das genannte Gesetz nicht auf die Fälle von Verbrechen gegen die Menschlichkeit angewendet werden könne. Die Reaktion der argentinischen Gesellschaft habe alle überrascht und sei selbst für die Optimistischsten unter ihnen unerwartet gewesen. Sein Eindruck sei, so Rafecas, dass die tausenden Menschen die Verfahren der Aufarbeitung, der Wahrheit und der Gerechtigkeit verteidigt hätten, als seien ihre eigenen Familienangehörigen betroffen. Es sei einer der bewegendsten Momente in seiner beruflichen Laufbahn gewesen. Ihm sei klar geworden, dass diese Reaktion der Bevölkerung die Ernte von 15 Jahren des juristischen Kampfes und des 40-jährigen Kampfes der Mütter, der Großmütter und der Menschenrechtsorganisationen gewesen sei.
Schulz wandte sich mit der Frage an Rommel, vor welchen praktischen Herausforderungen er in der internationalen Strafverfolgung stehe. Rommel antwortete, in historischer Perspektive habe die Bundesrepublik sich gegen das Modell der Alliierten entschieden. Diese hätten Gesetze zur besonderen Anwendung auf die Straftaten der Nationalsozialisten erlassen und eigene Strafgerichtshöfe wie zum Beispiel jenen in Nürnberg zur juristischen Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen eingesetzt. Die Bundesrepublik dagegen habe das alte Reichsstrafgesetzbuch angewendet und keine besonderen Organisationen mit der Strafverfolgung beauftragt, sondern diese entsprechend der dezentralen Struktur der Justiz in Deutschland in die Verantwortung der einzelnen Bundesländer gegeben. Diese Entscheidung habe zu großen Schwierigkeiten geführt, da zum einen das Strafgesetzbuch auf staatlich organisierte Massenverbrechen schlichtweg nicht zugeschnitten gewesen sei. Zum anderen habe sich auf institutioneller Ebene eine große Lücke aufgetan, denn Gerichte und Staatsanwaltschaften könnten nur Fälle bearbeiten, die in Deutschland begangen worden seien oder wenn der Beschuldigte in Deutschland ansässig sei. Die nationalsozialistischen Massenverbrechen wurden aber alle außerhalb Deutschlands begangen. Um diese Lücke zu überbrücken, habe man die Zentrale Stelle in Ludwigsburg geschaffen. Deren Struktur sei jedoch sehr kompliziert. Abgesehen davon, dass sie keine Befugnisse habe, habe sie zu wenig Personal, um alle Taten aufzuarbeiten. Die Arbeit der Zentralen Stelle sei es, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften vorzubereiten, auch auf internationaler Ebene. Die internationale Zusammenarbeit, so Rommel weiter, gestalte sich in dieser Hinsicht mitunter schwierig. Nationalsozialistische Straftaten müssten mit den üblichen Beweismitteln nachgewiesen werden. Bei Tatortbegehungen, Zeugenaussagen und Dokumenten benötigten sie die Hilfe des Auslands, v.a. Osteuropas. Leider habe die Bundesregierung jahrzehntelang die Zusammenarbeit mit den osteuropäischen Staaten verweigert. Auch bräuchten sie, wenn sie eines Täter habhaft werden wollten, die internationale Unterstützung beim Aufspüren oder spätestens bei der Auslieferung. Oft scheitere es am politischen Willen, weil Deutschland Auslieferungsersuchen nicht offensiv genug betreibe wie beispielweise im Falle Adolf Eichmanns oder weil südamerikanische und arabische Staaten Täter nicht ausliefern wollten. Offiziell berufe man sich meistens auf die Verjährung der Tat; es stünden aber auch politische Rücksichtnahmen dahinter. Unter diesen Umständen versuche die Zentrale Stelle bis heute zu ermitteln. Rommel hob hervor, dass sich die Zusammenarbeit mit der südamerikanischen Justiz in den letzten Jahren deutlich verbessert habe. Bei ihren Versuchen, deutsche Auswanderer aufzuspüren, erfahre man große Unterstützung durch die südamerikanischen Kollegen. Beispielsweise habe er im letzten April in Buenos Aires gemeinsam mit den dortigen Kollegen die Unterlagen der Einwanderungsbehörde nach Deutschen durchsucht, die mit bestimmten Reisedokumenten oder auf bestimmten Reiserouten nach Südamerika geflohen seien, um dort unterzutauchen.

Zum Abschluss der Diskussion bat Schulz um eine kurze, abschließende Stellungnahme der Podiumsteilnehmer, wo aus ihrer Perspektive die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft und auch der internationalen Zivilgesellschaft in der Zukunft liege.
Ríos Vega betonte, dass für Mexiko der Einfluss und Druck der internationalen Gemeinschaft von großer Bedeutung sei, damit die mexikanische Regierung die Probleme im Land nicht nur anerkenne, sondern auch in angemessener staatspolitischer Weise reagiere. Seiner Ansicht nach befindet sich Mexiko heute auf dem Weg zu einer Demokratie. Es werde ein Gesetz gegen Verschwindenlassens diskutiert und es organisiere sich eine Zivilgesellschaft, die sich vor allem aus den Familien, Müttern, Frauen und Kindern der vermissten Angehörigen zusammensetze. Sie forderten Gerechtigkeit, Transparenz und selbstverständlich die angemessene Verfolgung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Diese Organisationen und Foren seien wichtig. Sie ließen nicht nur zu, die gesellschaftlichen Probleme im Rahmen einer alle angehenden internationalen Agenda zu reflektieren, sondern auch, die Probleme zu lösen, v.a. da in Mexiko bereits Arbeitsmodelle existierten. Seit fünf Jahren arbeite er mit Familienangehörigen, mit der mexikanischen Regierung und den Vereinten Nationen zusammen, um alle internationalen Empfehlungen der Vereinten Nationen oder der interamerikanischen Organisationen im Falle von gewaltsamem Verschwindenlassen umzusetzen. Sie hätten ein Konzept des Dialogs und des Austauschs auf der Basis von Konsens und Einverständnis entwickelt, auch um diejenigen Gesetze zu formulieren, die notwendig seien, um die Probleme zu lösen und um die von den Familienangehörigen geforderte gesellschaftliche Aufmerksamkeit zu erreichen. Sie hätten ein kolumbianisches Beraterteam hinzugezogen, das sie bei den Ermittlungen und der Strafverfolgung der Verbrechen unterstütze. Jede Unterstützung auf der Grundlage internationaler Erfahrung sei willkommen, um diese Konzepte weiterzuentwickeln und um in angemessener Form auf die Opfer und ihre Familien reagieren zu können. Sollte sich der mexikanische Staat weigern, das Ausmaß des Problems zu erkennen, sei davon auszugehen, dass die organisierte Zivilgesellschaft, dass Familienangehörige und die allgemeine interessierte Öffentlichkeit den mexikanischen Staat zwingen würden, das Thema an erster Stelle seiner Agenda zu platzieren
Für Rafecas war es in seinem abschließenden Statement von großer Bedeutung eine Erkenntnis, die er im Rahmen seiner Arbeit gewonnen hatte, zu teilen. Diese Einsicht sei für ihn unerwartet gewesen. Als Richter sei er seit mehr als 13 Jahren in ständigem Kontakt mit Opfern und Tätern. Bei den Tatortbegehungen, bei der Rekonstruktion der abnormalen Vorgänge sei ihm bewusst, dass diese Arbeit dazu diene, den Opfern, der Gesellschaft und der Welt Wahrheit und Gerechtigkeit zu verschaffen und damit zum Prozess der Aufarbeitung beizutragen. Seine Erkenntnis ginge aber darüber hinaus. Es gehe darum, dass Opfer von Folter, Entführung und sexuellem Missbrauch oder die Angehörigen, die ihre Lieben verloren hätten, erlebten, dass die Täter dieser Verbrechen auf die Anklagebank gebracht und verurteilt werden. Es gäbe keine vergleichbare moralische oder sachliche Form der Wiedergutmachung. Er habe das immer wieder erfahren. Die Gerichtsverfahren hätten neben der Schaffung von Wahrheit, Gerechtigkeit und Vergangenheitsaufarbeitung das entscheidende Maß an faktischer und moralischer Wiedergutmachung für die Opfer mit sich gebracht. Die Prozesse hätten die Opfer an die Stelle der Opfer gestellt und die Täter an die Stelle der Täter. Diese grundlegende und einfache Klarstellung sei absolut entscheidend und wichtig für die gerichtliche Anerkennung als Opfer all derer, die von der Diktatur verfolgt worden seien. Die Staaten, in denen Menschenrechte verletzt worden seien, hätten die Strategie ökonomischer Wiedergutmachung verfolgt, aber diese sei absolut unbedeutend im Vergleich mit der moralischen und faktischen Wiedergutmachung, welche die Gerichtsverfahren in seinem Land bewirkt hätten.
Rommel erklärte, auch in Deutschland gehe die juristische Aufarbeitung weiter, nachdem der Gesetzgeber in einem mühsamen Entscheidungsprozess beschlossen habe, dass Mord nicht verjähre, und zwar insbesondere im Hinblick auf nationalsozialistische Verbrechen. Darin liege der Sinn der heutigen Prozesse. Die Länge der Freiheitsstrafe sei hierbei nicht entscheidend, vielmehr, dass sich der Staat und seine Justiz der staatlichen Verbrechen annehme. In einem formalen Verfahren müssten die Vorgänge und Abläufe geklärt und aufgedeckt werden. Beide Seiten würden gehört, sowohl Täter als auch Opfer könnten zu Wort kommen. Die Opfer und ihre Angehörigen hätten die Möglichkeit, sich aktiv als Nebenkläger an den Prozessen zu beteiligen. Mit einer Verurteilung werde auch ein lang zurückliegendes Verbrechen noch heute als Unrecht gekennzeichnet.
Schulz bat schließlich auch Däubler-Gmelin um ihr abschließendes Statement, dies fokussiert auf eine Bewertung des Stuttgarter Verfahrens im Zusammenhang mit den Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Demokratischen Republik Kongo auf Grundlage des Völkerstrafrechtgesetzbuches. Däubler-Gmelin sagte, dieses Verfahren entspreche genau der Zielsetzung, mit der das deutsche Völkerstrafrecht eingeführt worden sei. Denn so könnten die drei umfassenden Tatbestände Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen nicht nur vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verhandelt werden, sondern auch vor deutschen Gerichten. Die Verfolgung dieser Verbrechen durch nationale Gerichte sei wichtig, da der Internationale Strafgerichtshof nicht alle Fälle übernehmen könne. Natürlich, so Däubler-Gmelin weiter, brächten die Verfahren über ausländische Menschenrechtsverbrechen in Deutschland große Herausforderungen mit sich, beispielsweise hinsichtlich Beweisführungen und Zeugenaussagen. Die deutschen Gerichte seien zudem von der Kooperation des Staates, in dem die Taten verübt wurden, abhängig. Aber es müsse an diesen Verfahren festgehalten werden und sie erhoffe sich aus dem Stuttgarter Prozess Einsichten, wie die Verfahren optimiert werden könnten. Würden Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht von den zuständigen nationalen Gerichten verfolgt, müssten ausländische Gerichte tätig werden. Hier könne viel von der Erfahrung Argentiniens, Chiles oder Perus, die Informationen über diese Verfahren sammelten und archivierten und die abgerufen werden könnten, profitiert werden. Einer abwertenden Beurteilung der Internationalen Strafprozesse oder des Gerichtshofs in Den Haag müsse trotz aller Schwierigkeiten und Boykotte z.B. durch die USA, Russland, China und Indien entschieden entgegen getreten werden. Denn es würden Maßstäbe gesetzt, die auch für die nationalen Gerichte von Einfluss seien, wie am Beispiel Kolumbiens gesehen werden könne. Daher müsse die internationale Zusammenarbeit der Justiz nachdrücklich unterstützt werden.
SCHLUSSWORTE UND EMPFANG
Die Veranstalter bedankten sich bei allen Mitwirkenden des Symposiums und bei den etwa 300 Zuhörern. Der anschließende Empfang für die Mitwirkenden und geladene Gäste fand unter regem fachlichem und interkulturellem Austausch statt.
Vor dem Kleinen Senat, in dem der Empfang stattfand, zeigte das Haus der Geschichte Baden-Württemberg die in Zusammenarbeit mit dem Eberhard-Ludwigs-Gymnasium erarbeitete Schülerausstellung „Fritz Bauer – Jurist aus Leidenschaft“, die sich mit Leben und Wirken des bedeutenden Staatsanwaltes befasst.
Weitere Informationen finden Sie hier.












ELISABETH-KÄESEMANN-KOLLOQUIUM
Mittwoch 21. Juni, 10-12 Uhr